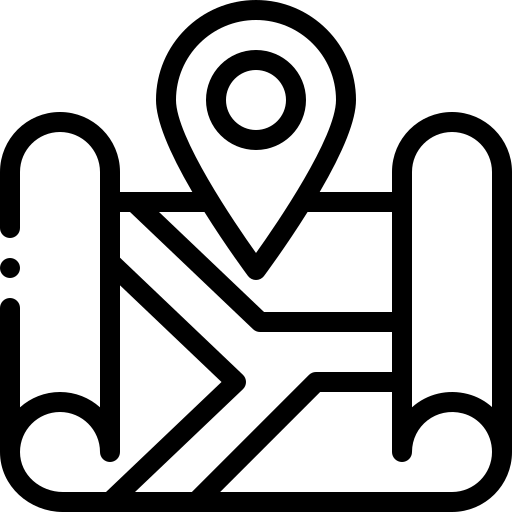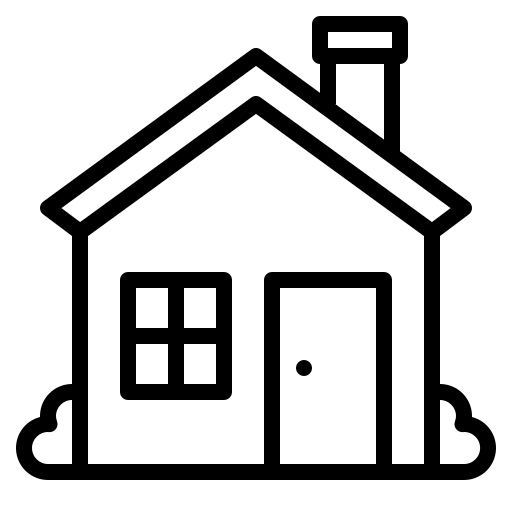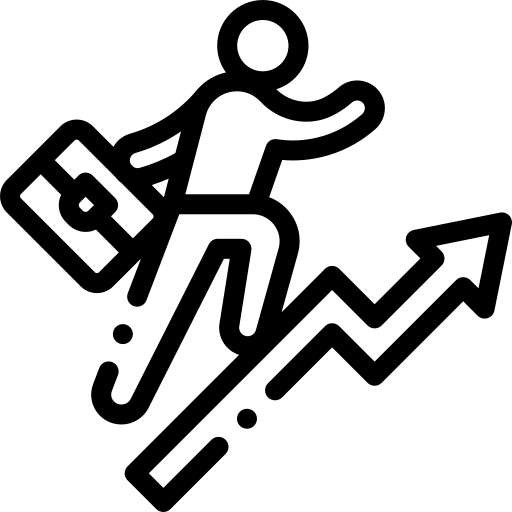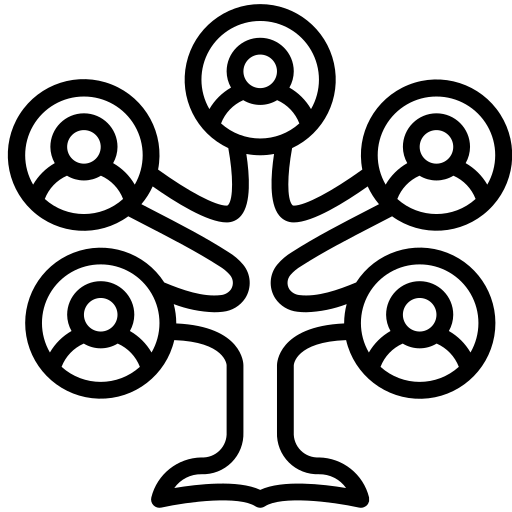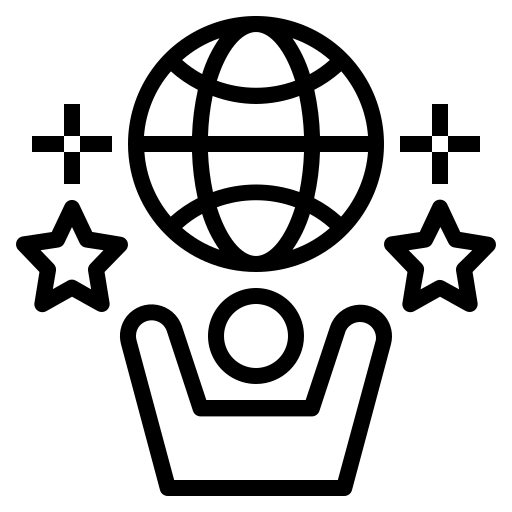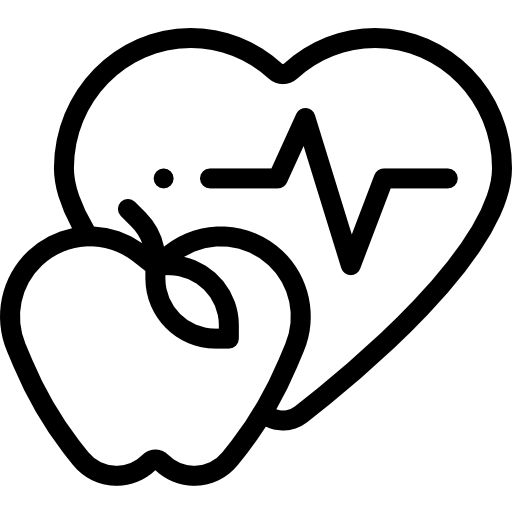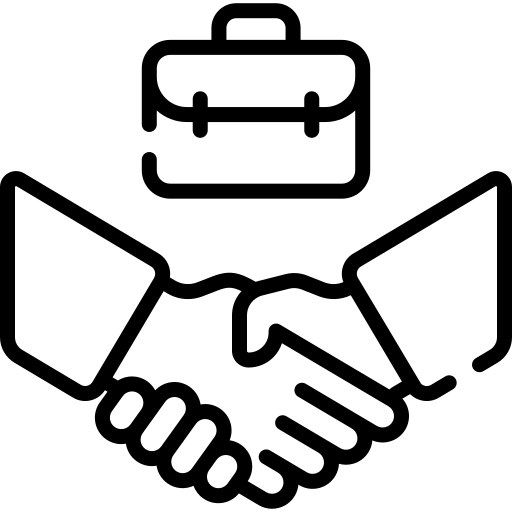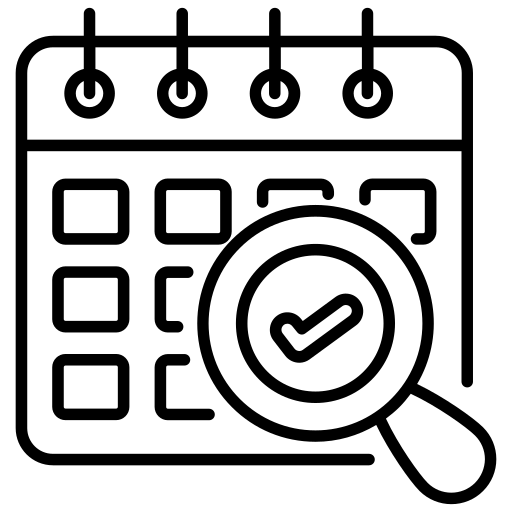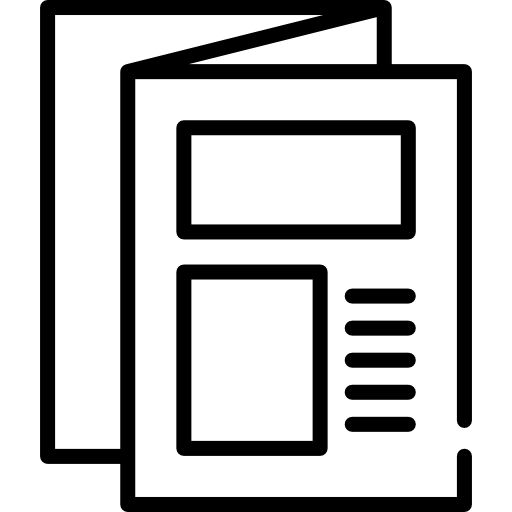Was hast du am 11. September 2001 gemacht? Wohl jeder Mensch in der westlichen Hemisphäre, der vor 1990 geboren wurde, kann diese Frage beantworten. Für Menschen in Israel wird die Frage„Was hast du am 7. Oktober gemacht?“ in den kommenden Jahrzehnten eine ähnliche Bedeutung annehmen.
In meinem Fall ist die Antwort simpel: Ich schlief. Ich schlief, als die Terroristen der Hamas an jenem Samstagmorgen den Grenzzaun zwischen Israel und dem Gaza-Streifen mit Bulldozern einrissen. Ebenso wie viele der Frauen, Männer und Kinder, die sie bald darauf in ihren Betten ermorden würden. Das Einzige, was ich zunächst von dem Angriff mitbekam, war die Sirene am frühen Morgen, die mich dazu zwang, für eine Viertelstunde Schutz im Treppenhaus zu suchen, so, wie es die Sicherheitsvorkehrungen in solchen Fällen vorschreiben.
Der Zeitpunkt war ungewöhnlich: Anders als bei früheren Fällen von Raketenbeschuss aus Gaza, die ich erlebt hatte, war diesem keine wesentliche Erhitzung des ewig schwelenden Konflikts vorausgegangen. Trotzdem wunderten meine Nachbarn und ich uns nicht übermäßig über den Angriff, während wir mit Pyjamas bekleidet auf den Stufen hockten. Denn egal, wie westlich der Alltag hier in Tel Aviv die meiste Zeit erscheint, leben alle in Israel in der stetigen Gewissheit, dass die Normalität in jedem Moment unterbrochen werden kann. Zum Beispiel von Raketenbeschuss aus Gaza an einem frühen Samstagmorgen.
Dass in diesen Momenten das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes begann, hätte ich mir nicht ausmalen können.
Ich lebe seit fast zehn Jahren in Israel. Bis vor Kurzem bin ich, wie wohl die meisten Menschen hier, davon ausgegangen, die großen Krisen dieses Landes seien ein Ding der Vergangenheit: der Yom-Kippur-Krieg, der das Land ums Überleben ringen ließ, die Giftgasdrohungen Saddam Husseins, selbst die blutige Welle von Selbstmordanschlägen der Zweiten Intifada Anfang des Jahrtausends schien mir wie ein Schrecken aus einem vergangenen Zeitalter. Der erbitterte Kampf um die sogenannten Justizreformen der Regierung Netanjahu, die deren Gegner als Versuch eines Systemwechsels sahen, erschütterte meine Annahme schon. Das hier war eine Krise, wie sie das Land noch nicht gesehen hatte, selbst geschaffen und deshalb besonders gefährlich: Dieses Land, das in den Jahrzehnten seines Bestehens so viel Geld, so viel Mühe, so viel Planung in die Abwehr äußerer Feinde gesteckt hatte, rang nun mit all seiner Macht mit sich selbst.
Und doch sah ich Grund zur Hoffnung in der unbeirrbaren Entschlossenheit, mit der Hunderttausende sich dem Vorhaben hinweg widersetzten, über Monate hinweg: Glücklich ist das Land, dachte ich, das eine solche Zivilgesellschaft hat.
Dann kam der 7. Oktober. Die Analogie zum 11. September greift eigentlich zu kurz: Sie vermag nicht die Tiefe des Traumas zu erfassen, das die Grausamkeiten der Hamas in die kollektive israelische Seele geschlagen haben. Dass manche der hiesigen Politiker zwar keine Parallelen, aber doch Verbindungen zum Holocaust ziehen, dient nicht nur dem Ziel, dem Ausland Empathie abzuringen. Es trifft auch die Gefühle, die viele Israelis äußern, Linke ebenso wie Rechte.
Israel ist ein kleines Land mit dafür um so größeren Freundes- und Familienkreisen; fast jeder kennt jemanden, der am 7. Oktober ermordet, verletzt oder entführt wurde. Auch deshalb ist der Schrecken so universell. In den ersten Tagen nach dem Angriff war der Schock unmittelbar spürbar: Selbst über Tel Aviv, diese sonst so lebhaft-lärmende Stadt, legte sich eine bleierne Stille, sogar das Hämmern der allgegenwärtigen Baustellen verstummte für kurze Zeit.
Inzwischen ist hier im Zentrum des Landes wieder eine scheinbare Normalität eingekehrt: Die Straßen sind bevölkert von Frauen in Yogakleidung, von Teenagern auf E-Scootern und jungen Paaren mit Hund und Kinderwagen. Selbst wenn, was manchmal passiert, das Schrillen der Sirenen die Menschen in den nächstgelegenen Bunker treibt, sieht eine Viertelstunde später wieder alles so aus wie vorher.
Doch überall an den Fassaden, Säulen und Schaufenstern der Stadt kleben Fotos der Entführten, überschrieben mit der Forderung: „Bringt sie nach Hause!“ Im Fernsehen laufen von morgens bis abends Sendungen über den Krieg. Jeden Morgen veröffentlicht die Armee die Namen der Soldaten, die in der Nacht zuvor gefallen sind. Und noch immer dringen neue Augenzeugenberichte und Erkenntnisse über die Grausamkeiten des 7. Oktober an die Öffentlichkeit.
Der Schock hat diese Gesellschaft zusammenrücken lassen
Das Leid der Zivilisten im Gazastreifen wird hierzulande nicht ausgeblendet, erhält aber eher wenig Aufmerksamkeit. Die Bilder von Passanten in Gaza, die Leichen von Israelis bespucken, haben den Eindruck vieler Menschen hierzulande bestärkt, dass nicht nur die Hamas, sondern auch viele ihrer Untertanen dem jüdischen Staat aufs Tiefste feindlich gesonnen sind.
Wie der 7. Oktober, dieser Schwarze Schabbat, wie ihn manche nun nennen, das Land auf lange Sicht verändern wird, lässt sich schwer abschätzen. Kurzfristig hat der Schock diese Gesellschaft, die zuvor als hoffnungslos gespalten galt, enger zusammenrücken lassen. Doch von Dauer wird der Effekt kaum sein, zu tief sind die Konfliktlinien im Inneren und zu unterschiedlich die Visionen der politischen Lager von der Zukunft des Landes - unter anderem, was sein Verhältnis zu den palästinensern betrifft. Darauf eine Antwort zu finden, bleibt eine der drängendsten Herausforderungen für dieses Land. Erst recht nach dem Schwarzen Schabbat.
VON MAREIKE ENGHUSEN