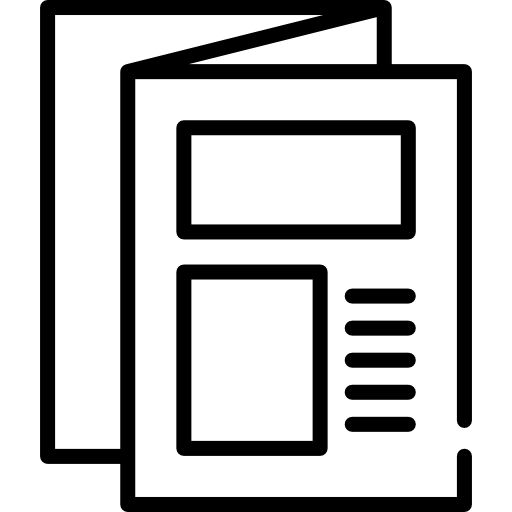Sport-Comeback
Die Vereine haben das Corona-Tief überwunden. Die Menschen wollen wieder gemeinsam kicken und turnen

Kontaktverbote, geschlossene Sportstätten, abgesagte Wettbewerbe – der Sport in Deutschland spürte die Corona-Pandemie massiv. Fast 800.000 Mitglieder verlor der organisierte Sport in den Jahren 2020 und 2021. Im Jahr 2023 feiert er nun das Comeback nach dem Corona-Tief. In Zahlen ausgedrückt: 27.874.195 Menschen sind Mitglied in deutschen Sportvereinen, gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bekannt. Das sind 815.000 Mitgliedschaften mehr als im Vorjahr. Verglichen mit der Bestandserhebung aus 2019, also dem Vor-Corona-Niveau, sind die Zahlen sogar etwas besser und auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren.
Die Menschen hätten wieder „richtig Lust auf Sport und Gemeinschaft im Verein“, sagt DOSB-Präsident Thomas Weikert. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen verbuchen die Vereine ein dickes Plus. Knapp 450.000 Sportbegeisterte aus der Altersgruppe bis 14 Jahren meldeten sich in Vereinen an. In der Pandemie hatte der fehlende Nachwuchs bei den Funktionären noch die tiefsten Sorgenfalten auf der Stirn verursacht.
Die größten Gewinner unter den Verbänden sind Basketball und Eishockey. Doch nahezu hinter jeder Sportart steht in der DOSB-Bestandserhebung ein Plus. Auch bei König Fußball. Und auch bei den Schützen, denen seit vielen Jahren ein verstaubtes Image anhaftet. Ausnahmen gibt es aber dennoch. Der Eisschnelllauf schlittert in Deutschland rasant bergab (minus 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Ebenfalls Gedanken um den ausbleibenden Nachwuchs müssen sich Fechter und Reiter machen. Allerdings fiel auch im großen Ganzen ein Wermutstropfen ins Champagnerglas des organisierten Sports. Und der stößt dem DOSB bitter auf. „Wir wissen von Verbänden und Landessportbünden, dass es teilweise sogar noch mehr neue Mitglieder hätten sein können, wenn mit ausreichend Sportstätten und mehr ehrenamtlicher Unterstützung im Trainerinnen/Trainer- und Übungsleiter-Bereich bessere Rahmenbedingungen herrschen würden“, sagt Michaela Röhrbein, im Vorstand des Dachverbandes zuständig für die Sportentwicklung. Das ist geschafft, darauf ausruhen dürfen sich Vereine und Verbände aber nicht. ses
Bissig und prägnant
Jochen Ott ist neuer Oppositionsführer in NRW

Es hat sich einiges geändert, seitdem der Kölner Jochen Ott am 23. Mai zum SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag gewählt worden ist. Besonders augenfällig, nein ohrenfällig: Es ist lauter geworden, wenn der Oppositionsführer spricht. Vorbei ist es mit den leisen Tönen des in diesem Jahr als SPD-Landes- und -Fraktionschef abgelösten Thomas Kutschaty. Der Debattenredner Ott mag es bissig, prägnant und pointiert – und er zeigt damit einen bei der SPD lange vermissten Kampfgeist. Wie sagte er noch in der Haushaltsdebatte vor gut zwei Wochen zu Ministerpräsident Hendrik Wüst? „Sie erinnern mich an einen ehemals sehr populären Bundesminister: Erst tolle Fotos und eine tolle Show. Dann schlechte Entscheidungen und fatale Versäumnisse. Am Ende war die Bundeswehr ein Sanierungsfall. Kann es sein, dass Sie der Guttenberg von Nordrhein-Westfalen sind?“ Mit starken Worten allein machen Ott und die neuen Landesvorsitzenden Sarah Philipp und Achim Post die NRW-SPD natürlich nicht konkurrenzfähig. Der WDR sieht sie bei mageren 18 Prozent. Und doch: In der Schul-, Kita- und Wohnungsbaupolitik sowie der Aufarbeitung des A45-Brückendesasters etwa setzt die SPD auch inhaltlich wichtige Akzente. ye
Neue Bahnen
Steven Walters frischer Wind beim Beethovenfest

Sein zweites Beethovenfest zeigte, dass der neue Intendant Steven Walter (37) endgültig angekommen ist. Seit 2015 hatte das Festival nicht mehr so gute Auslastungszahlen wie in diesem Jahr. Und das, ohne die Beethovenhalle als zentrale Spielstätte nutzen zu können. Kein Wunder, dass die Bonner Politik gerade seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat. Der ausgebildete Cellist Walter erreicht sein Publikum nicht nur mit den großen Namen der Klassik und populären Programmen, sondern vor allem auch mit musikalischen Überraschungen, fantasievollen Innovationen und ganz neuen Formaten, die er oft an ungewohnten Schauplätzen ausprobiert wie der Bonner Fahnenfabrik oder dem Post Tower, den Walter auf mehreren Etagen gleichzeitig bespielen ließ. Selbst sein Tiny House wird zum Konzertsaal, zusehen kann man per Videostream. Dass in Bonn mit ihm auch die Zukunft der klassischen Musik eine Heimat gefunden hat, zeigte besonders schön die beim Beethovenfest erfolgte Neugründung des one Music Orchestra, dessen erstes Konzert in Bonn der Dirigent Yoel Gamzou mit gleich vier Uraufführungen leitete. Sie hielten sich streng an Walters Devise: „Neue Musik soll genauso begeistern wie klassische.“ ht
Ein Traum wird wahr
Der Bonner Pianist Fabian Müller auf der Erfolgsspur
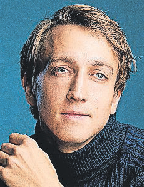
Schon als Schüler träumte der Bonner Pianist Fabian Müller davon, irgendwann einmal mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und ihrem Chefdirigenten Paavo Järvi Beethoven spielen zu dürfen. Damals, vor fast zwei Jahrzehnten, begeisterten die Bremer beim Beethovenfest mit ihrer erfrischend lebendigen Art, die Sinfonien Beethovens aufzuführen. In diesem Jahr ist der Traum wahr geworden. Müller, Järvi und die Bremer spielten im Dezember in der Kölner Philharmonie, im Wiener Konzerthaus, in der Concert Hall in Dublin und schließlich auch in der Hamburger Elbphilharmonie. Auf dem Programm: natürlich Beethoven. Doch das war nur der krönende Abschluss eines sehr erfolgreichen Jahres, das der heute 33-Jährige absolvierte. Ebenfalls an der Seite von Järvi trat er als Residenzkünstler mit dem Tonhalle-Orchester Zürich beim Beethovenfest auf und gestaltete zudem ein musikalisches Stadtteilfest in seiner Heimatgemeinde in Endenich. Die dortige Trinitatiskirche, in der Müllers Vater lange als Pastor wirkte, ist übrigens Namensgeber seines eigenen Orchesters. Mit dem taufrischen Ensemble The Trinity Sinfonia debütierte Müller in diesem Jahr beim Rheingau Musik Festival. ht
Selbstbewusster Weltmeister
Dennis Schröder führt die Basketballer zum Titel

Die deutschen Sportler haben schon bessere Zeiten erlebt als das Jahr 2023. Insbesondere die Mannschaftssportler. Doch da erobern die Basketballer, von Bonn aus startend, was kaum jemand für möglich gehalten hätte: den Weltmeistertitel. Angeführt von Teamkapitän Dennis Schröder beginnt die Reise mit dem Lehrgang und dem Test gegen Schweden im Telekom Dome. Auf dem Weg auf den Thron schlagen die Deutschen hoch eingeschätzte Australier, die Slowenen um Superstar Luka Doncic und im Halbfinale die USA. Die „Mission Manila“ hat eine überwältigende Dynamik aufgenommen, der auch Serbien im Finale nicht standhalten kann. Deutschland ist zum ersten Mal Weltmeister. Dass Dennis Schröder, der Spieler des Turniers, anschließend verlangt (!), deutscher Fahnenträger bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu sein, ist wieder ein typischer Schröder. Und Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker. Schröder ist kein Schwiegermutter-Liebling, kein Nowitzki. Die Vergleiche sind Unsinn. Schröder ist Schröder. An seinen Fähigkeiten als Basketballer gibt es wenig Zweifel. Und ohne dieses ausgeprägte Selbstbewusstsein, mit dem viele Deutsche fremdeln, wäre der Basketballer Schröder nur halb so gut. scht
Heimweh nach Köln
Philipp Hoffmann wechselt nicht ins Stadtmuseum

Er galt als Wunschkandidat von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, doch dann zog Philipp Hoffmann, der Chef des Bonner Stadtmuseums, seine Bewerbung als neuer Direktor des Kölnischen Stadtmuseums zurück. Offenbar hatten SPD und Grüne im Stadtrat das CDU-Mitglied Hoffmann nicht mittragen wollen. „Leider haben mir Teile der Politik und des Fördervereins das Vertrauen entzogen, noch bevor ich einen ersten Tag für das Museum arbeiten konnte“, wurde er nach dem Rückzug in einer Meldung des Kölner Presseamtes zitiert.
Für Hoffmann wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gewesen. Im Kölnischen Stadtmuseum hatte er als leitender Wissenschaftler in der Brauchtums-Abteilung gearbeitet, bevor er nach Bonn wechselte. Hier folgte der Historiker 2021 auf die langjährige Stadtmuseumsleiterin Ingrid Bodsch und übernahm das Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur, wie seine Abteilung offiziell heißt. In Bonn bleibt ihm mit dem anstehenden Umzug von Stadtarchiv und Stadtmuseum nun eine zentrale und anspruchsvolle Aufgabe erhalten. Die Position in Köln ist inzwischen mit dem Kunsthistoriker Matthi
Abschied aus dem Stadthaus
Dezernentinnen Heidler und Krause müssen gehen

Eine fachliche Begründung für diese angekündigten Personalentscheidungen blieb die Bonner Ratskoalition schuldig. Und so schoss ungehindert die Spekulation ins Kraut, dass es schlicht am „richtigen“ Parteibuch hapert. Nach aktueller Lage der Dinge haben Sozial- und Familiendezernentin Carolin Krause und Stadtkämmerin Margarete Heidler (Foto) keine Chance, dass das Bündnis aus Grünen, SPD, Linken und Volt sie für eine weitere achtjährige Amtszeit wählt. Die Amtszeit von CDU-Mitglied Krause endet Anfang 2025; die von Stadtkämmerin Heidler (parteilos), auch zuständig für Recht und Gesundheit, bereits Ende 2024. Über mögliche Nachfolger wurde öffentlich bislang noch nichts bekannt. Kritik an der Personalie gibt es deshalb, weil die Stadt die scheidenden Dezernentinnen über die Pensionsansprüche weiterbezahlen muss. Aus heiterem Himmel findet sich seit der jüngsten Sitzung des Bonner Stadtrats zudem Stadtbaurat Helmut Wiesner (parteilos) in einer Hängepartie wieder. Entgegen der Zusage der Koalition für eine zweite Wahlzeit, die ab Mai 2024 beginnen soll, fand seine Wiederwahl keine Mehrheit. Im neuen Jahr soll es ein zweiter Versuch richten. fa
Knick in der Karriere
Kollegen-Protest gegen Bonner Ökonomen Falk

In seinen Forschungen beschäftigt sich der Wirtschaftswissenschaftler Armin Falk mit menschlichem Verhalten und seinen ökonomischen Folgen. In seinem letzten Buch ging Falk der titelgebenden Frage nach, „Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein“. Ein Thema: die „moralischen Stolperfallen, in die wir immer wieder geraten“, wie er im GA-Interview sagte.
Über eine Art von moralischer Stolperfalle stürzte der Bonner Ökonom nun selbst. Seine Berufung zum Chef des Bonner Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA), das unter seiner Leitung mit dem bereits von ihm geführten Institut für Verhaltensökonomie und Ungleichheit (briq) verschmelzen sollte, verhinderten mit einem Protestbrief fast 700 Mitglieder des weltweiten IZA-Forscherinnen- und Forschernetzwerks. Den Widerstand begründeten die Kollegen unter anderem mit zurückliegenden Vorwürfen von Führungsfehlverhalten gegen Falk – für die unabhängigen Untersuchungen allerdings keine Anhaltspunkte gefunden hatten. Am Ergebnis änderte das nichts: Der einflussreiche Posten des IZA-Chefs bleibt Falk versperrt – ein empfindlicher Karriereknick für den Bonner Ökonomen. pfu
Der gefallene Spargelkönig
Landwirt Claus Ritter muss für drei Jahre in Haft

Drei Jahre Haft für Claus Ritter. Gefällt wurde das Urteil Ende November. Ritters Ehefrau erhielt anderthalb Jahre auf Bewährung. Damit endet vorläufig die Geschichte des bekannten Spargel- und Erdbeerbauers. Das Ehepaar wurde wegen vorsätzlichen Bankrotts in 34 Fällen und veruntreuender Unterschlagung verurteilt, Claus Ritter zudem wegen Betrugs und falscher Versicherung an Eides statt. Die Eheleute müssen rund 1,7 Millionen Euro zurückzahlen, Claus Ritter alleine weitere 1,3 Millionen Euro. Der Aufstieg des Bornheimer Spargelkönigs begann Ende der 1990er Jahre. Zuvor hatte das Ehepaar nebenbei Erdbeeren, Spargel und anfangs auch anderes kultiviert. Das lief gut, und so wurde aus einem Nebenerwerb ein erfolgreiches Vollzeitgeschäft. Allerdings wurden die Gewinne nicht in den Betrieb gesteckt. Es wurden keine ausreichenden Rücklagen gebildet, fast die gesamte Anbaufläche war gepachtet. Um 2017 herum begann der Niedergang: schlechtes Wetter, gestiegene Bewässerungskosten und unternehmerische Fehlentscheidungen. Ritter frönte seiner Leidenschaft für Oldtimer und wollte ohne Genehmigung ein Restaurant bauen. Am Ende brach alles zusammen. meu
Gestürzte Ikone
Greta Thunberg mischt sich in den Nahostkonflikt ein - und spaltet damit die Klimabewegung

Der einsame Protest einer 15-Jährigen setzte eine Bewegung in Gang: Mit einem Schild mit der Aufschrift „Skolstrejk för Klimatet“ (Schulstreik für das Klima) protestierte Greta Thunberg jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament gegen zu wenig Tempo beim Klimaschutz – Geburtsstunde der Bewegung „Fridays for Future“, der Millionen Menschen folgen. Die ernste Schülerin mit der Strickmütze und den Zöpfen wurde zu einer Ikone des Klimaschutzes.
Mittlerweile ist Thunberg 20, Staatschefs und Spitzenpolitiker zeigen sich mit ihr, sie ist eine gefragte Rednerin auf Protestbühnen weltweit – und erweitert ihr Themenfeld. Bei einer Großveranstaltung in Amsterdam ergreift sie auf der Bühne Partei für die Palästinenser im Gazastreifen. Mit einem schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals sagt Thunberg vor Zehntausenden Zuhörern, die Klimaschutzbewegung habe die Pflicht, „auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen“. Sie skandiert den Slogan „No climate justice on occupied land“ („Auf besetztem Land gibt es keine Klimagerechtigkeit“). Über den Terrorangriff der islamistischen Hamas, über die ermordeten 1400 Israelis, über die entführten Geiseln spricht Thunberg nicht.
Es bleibt nicht die einzige Gelegenheit, bei der sie Partei gegen Israel ergreift. Insbesondere in Deutschland stößt das auf Unverständnis und harsche Kritik. Der Zentralrat der Juden wirft ihr Naivität und Nähe zum Antisemitismus vor. Die deutsche Sektion der Fridays for Future distanziert sich. Verstörte Aktivistinnen und -aktivisten wehren sich dagegen, den Kampf für das Klima mit dem Nahostkonflikt zu vermischen. Und plötzlich scheint es, als stehe die zornige junge Frau, die den Mächtigen der Welt die Leviten liest, auf einer zu großen Bühne. Als eine 20-Jährige, die altersgemäß über den komplexen Nahostkonflikt nicht allzu viel weiß, aber trotzdem darüber spricht. Ihre Anhänger stilisierten Greta Thunberg zu einer Heiligen, einer unbestechlichen Kämpferin für das Gute – eine Überhöhung, gegen die sie sich nicht erkennbar wehrte. Mit ihren schlecht bedachten Äußerungen zum Nahostkonflikt hat Thunberg den Heiligenschein verloren. pfu